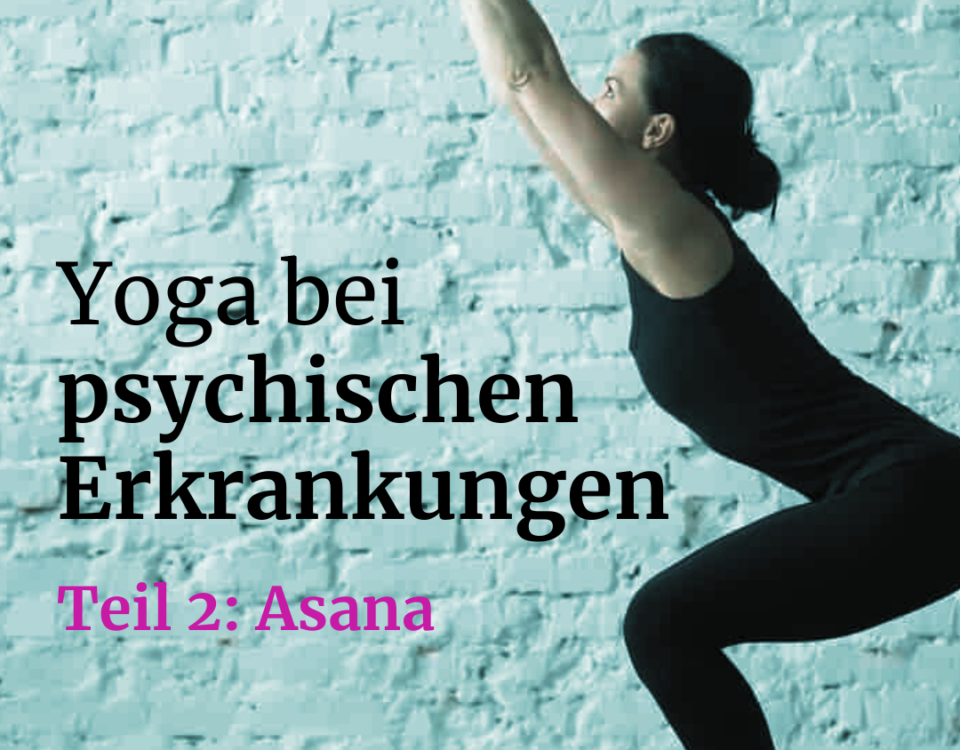Abhiniveśaḥ – die Todesfurcht, Yoga Sutra 2.9
24. August 2024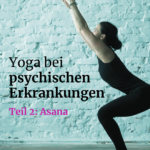
Yoga bei psychischen Erkrankungen – Teil 2: Asana
3. Dezember 2025Yoga bei psychischen Erkrankungen – Teil 1: Achtsamkeit
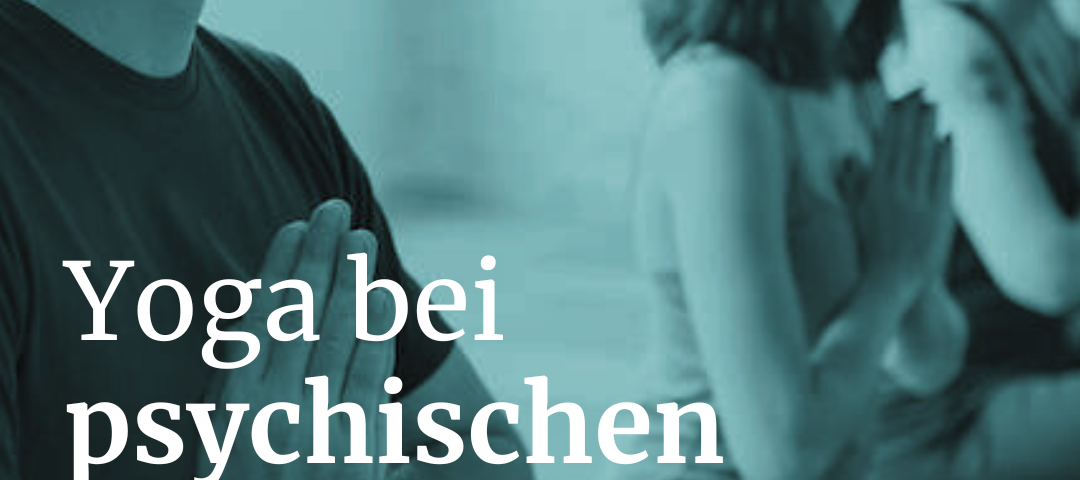
Yoga bei psychischen Erkrankungen
Teil 1: Achtsamkeit
Die Studienlage zu Yoga bei psychischen Erkrankungen verdichtet sich zunehmend. Viele Untersuchungen zeigen, dass Yoga – insbesondere bei depressiven Symptomen – eine wertvolle und unterstützende Wirkung entfalten kann. Schon die regelmäßige Ausführung bewusster Bewegung und Atmung wirkt nachweislich gesundheitsfördernd.
Damit Betroffene maximal von ihrer Yogapraxis profitieren können, braucht es einen geeigneten Yogastil und eine angemessene Anleitung der Praxis.
Menschen mit psychischen Erkrankungen brauchen oft eine „andere“ Art des Yogapraktizierens
Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Einschränkungen sind in „klassischen“ Yogakursen oft nicht optimal aufgehoben. Sie benötigen eine Yogapraxis, die auf ihre individuellen Möglichkeiten, Belastbarkeiten und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Für Yogalehrende im klinischen oder therapeutischen Bereich bedeutet das, bewusst und differenziert zu unterrichten. Hier kommt der Aspekt der Achtsamkeit ins Spiel.
Achtsamkeit
Viele Betroffene haben ein vermindertes Gespür für ihren Körper. Ihre Aufmerksamkeit ist häufig stark an Gedanken gebunden – an Grübelschleifen, Zweifel oder gedankliche Szenarien. Eine achtsame Yogapraxis hilft, den Fokus wieder in den gegenwärtigen Moment zu bringen, in das, was unmittelbar spürbar und real ist.
So können Menschen mit Depressionen oder Angststörungen ihren Körper wieder auf eine konkrete, erfahrbare Weise wahrnehmen – im Gegensatz zu den oft überwältigenden inneren Bildern, Sorgen oder Befürchtungen. Die Vielzahl an Körperempfindungen, die schon in einer kurzen Yogasequenz entsteht, bietet dem Geist eine hilfreiche Struktur: Er kann gebunden, beruhigt und geschult werden. Selbst wenn die Körperwahrnehmung anfangs schwierig ist, lässt sich etwa wahrnehmen, wie die Füße den Boden berühren oder wie sich einzelne Muskeln in einer Haltung anspannen und entspannen.
Dabei können natürlich auch Verspannungen oder unangenehme Empfindungen auftauchen. Diese betrachten wir als das, was sie sind: körperliche Empfindungen, die in diesem Moment wahrnehmbar sind – Empfindungen, die sich verändern, verstärken oder abschwächen, kommen und gehen. Immer wieder kehren wir mit einer freundlichen, nicht wertenden Haltung zu diesen Empfindungen zurück.
Gerade die automatische Bewertung – oft negativ und unbewusst – trägt maßgeblich zum Leiden bei. Im achtsamen Yoga üben wir daher, bei der unmittelbaren Körpererfahrung zu bleiben, sie eher zu beschreiben als zu interpretieren und ihr mit Akzeptanz und Neugier zu begegnen.
Die Herausforderung des achtsamen Übens
Dieses „Sich-Spüren“ oder „Zurückkommen in den Körper“ kann herausfordernd sein. Oft flüchtet der Geist, um schmerzhafte oder unangenehme Empfindungen zu vermeiden, insbesondere wenn alte oder verdrängte Erfahrungen berührt werden. Daher sollte die Praxis so gestaltet werden, dass der Fokus flexibel zwischen der inneren Wahrnehmung und äußeren Ankerpunkten wechseln kann – immer im Tempo und nach den Bedürfnissen der Klient*innen. Wenn Empfindungen zu intensiv werden, kann die Aufmerksamkeit bewusst auf neutralere Körperbereiche oder andere Elemente der Praxis gelenkt werden. Der therapeutische Yoga bietet hierfür eine Vielzahl an Möglichkeiten.
Im Verlauf der Yogatherapie geht es darum, innere Empfindungen zunehmend wahrnehmen, annehmen und regulieren zu können. Dadurch verlieren sie ihre überwältigende Wirkung, während die Fähigkeit zur emotionalen Selbstregulation wächst.
Wichtig: Yogatherapie versteht sich immer als ergänzendes Angebot und ersetzt keine medizinische oder psychotherapeutische Behandlung.
Integrale Yogatherapie-Ausbildung
Wenn Du mehr über Yogatherapie bei psychischen und stressbedingten Erkrankungen erfahren möchtest, dann informiere dich hier über die Integrale Yogatherapie-Ausbildung
Fotocredits: rawpixel.com